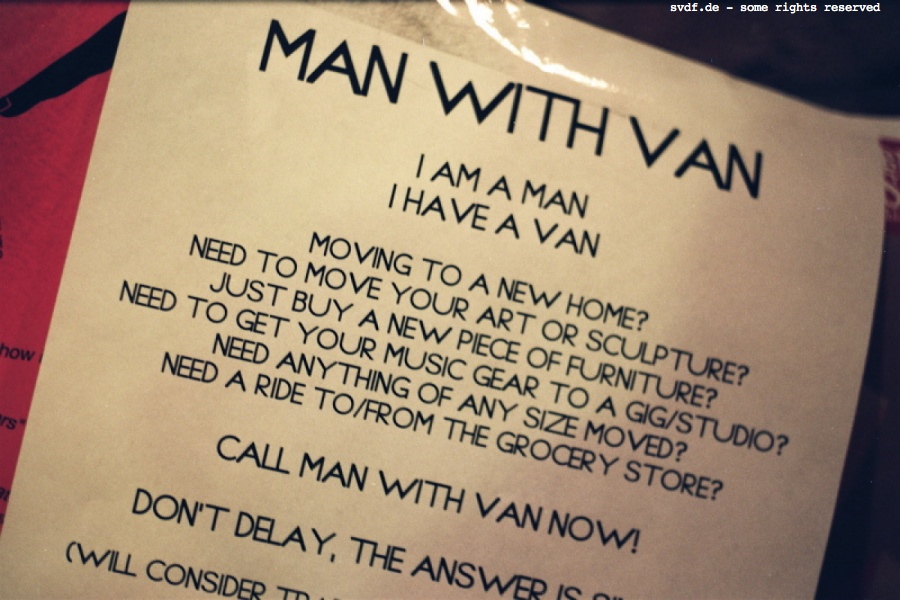new york zum winterende 2008. manhattan.
weil der kalte wind pfeift, sind die finger schnell gefühllos. ein foto zu machen wird zur tour de force, besonders, wenn das objektiv gewechselt werden soll. alle halbe stunde suchen wir wegen der kälte ein café zum aufwärmen und finden meist ein zugiges schnellrestaurant. downtown ist es laut und hektisch, die bewohner verschließen die ohren vor den geräuschen der stadt und hören musik. viele haben große pappbecher kaffee in der hand und eilen mit dem handy am ohr durch die straßen. sehr wenige lesen zeitung, auch in den cafés sehe ich das selten. in der subway kleben aufkleber mit hinweisen: if you see something, say something. das amerikanische englisch ist so knapp, und jeder spricht es anders aus. erstaunlich, dass die amerikaner sich gegenseitig verstehen. plakate in den subwaystationen preisen erfolg an – dabei scheint er jeden zweck zu verlieren und wird als wert an sich gefeiert. im kopf bleibt hängen wie ein nerviger sommerhit: up … up … up … up …



auf der gegenüberliegenden seite des broadway ecke 151. straße stehen zwei häuser, auf deren dächern sich den ganzen tag über tauben sammeln. wenn es genug sind und ein für das menschenauge unsichtbares zeichen gegeben wird, schwingen sich alle in die lüfte und kurven in gewagten achten über die kreuzung. das machen sie den ganzen tag, einfach so, und man kann ihnen zugucken und kaffee trinken und darüber den trubel der stadt vergessen.

die häuser sind wesentlich schöner, als ich mir das vorgestellt hatte, mit ihren feuerleitern, die bei sonne schräge schatten über die hauswand werfen. das wohnen scheint mir eine art charmante dauernotlösung zu sein. zumindest über unser haus lässt sich kein urteil fällen, ohne ein „aber“ dranzusetzen: ein geradezu festlich aussehender eingangsflur mit glänzendem marmorimitatboden führt zu einem fahrstuhl, der mich stark an den fahrstuhl meines ehemaligen zuhauses in bratislava erinnert, meine zweifel an seiner zuverlässigkeit sind ähnlich groß. der blick aus dem fenster richtung westen führt auf den broadway, links unten liegt downtown manhattan, rechts oben wird es familiärer in harlem. unser haus steht auf dem sugar hill und man kann in den himmel gucken. doch der blick aus dem nachbarzimmer gen norden führt direkt in eines anderen wohnung. jemand, der das zimmer mieten will, müsste gut 800 dollar zahlen und bekommt dafür tag und nacht gasgeruch und klimaanlagengedröhn vom feinsten. plus jeden morgen einen „aufheiternden“ blick in eine bizarre hausschlucht. das härtet ab.
alle paar wochen kommt ein typ mit einem spritzgerät vorbei und erschreckt die muntere kakerlakenpopulation in der küche. komfortabel ist es nicht, aber es ist schön, sich unten in der bodega abends ein paar bier zu holen und dann im sechsten stock aus dem fenster zu steigen, um die sicht von der feuerleiter aus zu genießen. viele der bewohner besuchen sich abends gegenseitig, feiern wohnungsübergreifend (zur zeit gibt es obama-support-parties) und wissen, dass die leisen posaunentöne auf dem weg zur treppe bedeuten, dass bobby übt. das haus lebt.

die entspannteren orte, die wir gesehen haben, waren unsere „neighbourhood“ – der südliche rand von harlem, und williamsburg im norden brooklyns. williamsburg wirkt fast schon europäisch, mir jedenfalls war die gegend mit ihren cafés, kneipen, plattenläden und second-hand-shops intuitiv vertrauter als jede andere ecke der stadt, die wir gesehen haben. vom central park abgesehen. der und seine dicken grauen eichhörnchen verdienen aber einen eigenen eintrag, ebenso wie coney island …